Fördergerüste im Ruhrgebiet | headgear | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Eine kurze
Entwicklungsgeschichte der Schachtförderanlagen:
- Diese Seite ist veraltert! Link ->
Neue Seite
Da die durch den Pingen- und
Stollenbergbau leicht zu erreichenden oberflächennahen Flöze im
Ruhrtal sowie südlich davon bereits um das Jahr 1820 größtenteils
abgebaut waren, wurde es notwendig auch die weiter nördlich
gelegenen überlagernden Erdschichten zu durchteufen, um an das sich
mit etwa 5 bis 7° nach Norden hin absenkenden Karbon zu gelangen.
Zu Anfang war dies noch relativ leicht durchführbar, da die seigeren
oder tonnlägigen Schächte nur eine geringe Teufe erreichen mussten
um an das begehrte Mineral zu gelangen. Problematisch wurde es erst,
als die weiter nördlich gelegenen Mergelauflagerungen durchteuft
werden mussten. Dieses hatte besonders mit der damals noch
unausgereiften Beherrschung des zufließenden Tiefenwassers und der
noch mangelhaften Abteufsysteme zu tun.
Der Übergang zum eigentlichen Tiefbau mit dem erfolgreichen
Durchteufen der das Karbon überlagernden Mergelschicht, erfolgte im
Ruhrgebiet erstmals im Jahr 1832 durch den Schacht Franz der im
Mülheimer Gebiet liegenden Zeche Humboldt. Vorher hatte man zwar
schon tiefe Schächte abgeteuft, diese lagen aber südlich des
Mergelhorizonts und waren daher per Definition noch keine
Tiefbauschächte.

Der geognostische Längstschnitt zeigt die Lage des Mergelhorizonts
(grün) im Bereich Bochum - Gladbeck
In den folgenden dreißig Jahren war der
Bergbau aufgrund des immer weiter ansteigenden Kohlebedarfs bereits
weiter nach Norden vorgedrungen und befand sich um 1850 etwa in
einer Linie mit den Städten Essen-Bochum-Dortmund. Die tiefste
damals gebaute Teufe lagen bei etwa 300 Metern (Zeche Gewalt) und
musste bei den damals verliehenen kleinen Grubenfeldern zügig weiter
in die Tiefe fortschreiten, da speziell Zechen mit geringer
Feldesgröße gezwungen waren in schneller Folge die Flöze abzubauen,
um konkurrenzfähig zu bleiben.
Zu dieser Zeit begann man dann auch mit dem verstärkten Bau von
Malakofftürmen, da die zur Fördersteigerung notwendigen baulichen
Veränderungen (Leistung der Fördermaschinen, Hängebankhöhe,
mehretagige Förderkörbe, Seilscheibengröße etc.) beträchtliche
statische Probleme bei den hölzernen Gerüsten hervorriefen, welche
nur durch die gemauerten Türme technisch bewältigt werden konnten.
Die Holzgerüste erreichten zu diesem Zeitpunkt bereits Höhen von
mehr als 20 Meter und es wurde immer schwieriger geeignete
Baumstämme zu beschaffen; zudem war auch die Statik und
Standfestigkeit infolge der nun zwangsweise geteilten Bauweise
(notwendige Anschlüsse) und des unvermeidlichen Schwindens
(Schrumpfung) beim Austrocknen des Holzes für einen sicheren und
leistungsstarken Förderbetrieb kaum mehr ausreichend. Des Weiteren
führte die hohe Brandgefahr sowie die verminderte Haltbarkeit der
hölzernen Konstruktionen - speziell bei ausziehenden Wetterschächten
- zu der Überlegung eiserne Fördergerüste zu errichten.
Aber auch die verwendeten Malakofftürme hatten Ihre Nachteile. So
waren bei diesen die Baukosten sehr hoch, die Erstellungszeit sehr
lang - da diese nicht bereits beim Abteufen erbaut werden konnten
und eine massive Mauerung notwendig war - und bei Bränden war die
Reparatur zeitraubend und kostenintensiv. Auch war eine Anpassung
auf geänderte Förderbedingungen relativ schwierig und so musste
schon beim Bau auf alle Eventualitäten größte Rücksicht genommen
werden, da spätere Änderungen kaum mehr möglich waren.
Ungeachtet der zahlreichen Nachteile der hölzernen Gerüste als auch
der Malakofftürme und trotz der zumeist positiven Erfahrungen,
welche im benachbarten Ausland [Frankreich - hier wurde bereits 1864
das erste freistehende stählerne Fördergerüst erstellt- , England
und Belgien] mit dem Einsatz von eisernen Gerüsten gemacht wurden,
konnten sich die sehr konservativen deutschen Bergbaugesellschaften
noch lange Zeit nicht dazu durchringen, eiserne Fördergerüste zu
erbauen.
Ein weiterer Grund für das zögerliche
Verhalten war sicherlich der hohe Roheisenpreis in der Zeit vor dem
deutsch-französischen Krieg. Deutschland war zu dieser Zeit nicht in
der Lage genügend Roheisen zu produzieren und musste daher dieses
vornehmlich aus England importieren, welches den Stahlpreis deutlich
erhöhte.
Ein Umdenken setzte erst 1870 ein, in diesem Jahr wurde der durch
den Zollverein erhobene sogenannte Eisenzoll um 50% reduziert und
somit wurden auch die Erzeugnisse günstiger. Auch führten die durch
den gewonnenen deutsch-französischen Krieg erhaltenen
Reparationskosten aus Frankreich zu einer wirtschaftlichen Gesundung
und regen Investitionstätigkeit (Gründerjahre) der Industrie, welche
allerdings nur von kurzer Dauer war.

Nordgrenze der Ausdehnung im Jahr 1850
Nach mehreren Schachtbränden, bei denen
die hölzernen Fördergerüste sowie ein großer Teil der Tagesanlagen
komplett zerstört wurden und ein beträchtlicher wirtschaftlicher
Schaden enstand, entschloß man sich im Jahre 1869 aber schließlich
doch zum Bau des ersten eisernen Fördergerüstes. Hierzu hatte man
den durch einen Brand zerstörten Schacht Barillon der Zeche Julia in
Herne gewählt, welcher dann mit einem vierbeinigen Pyramidengerüst
ausgerüstet wurde.
Im Folgejahr wurde auf der Zeche Graf Beust in Essen bereits das
erste stählerne Strebengerüst (das zweite eiserne Fördergerüst im
Ruhrrevier) errichtet, welches als erstes eigentliches Strebengerüst
und somit als Initialzündung der Fördergerüstentwicklung bis zu der
uns heute bekannten Formgestaltung gesehen werden kann. Damit war
zwar die Zeit der "eisernen" Schachtgerüste im Ruhrgebiet
angebrochen, diese Entwicklung wurde aber bereits 1873 durch den
Börsenkrach und die darauf folgende zwanzigjährige wirtschaftliche
Stagnationsphase deutlich abgeschwächt und der "Siegeszug" der
Stahlgerüste wurde dadurch verlangsamt.
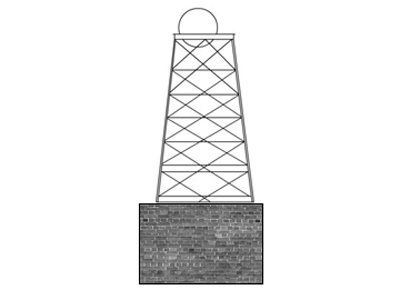
Abbildung 1: Das 1869 von der Cölnischen
Maschinenbau-Aktiengesellschaft erbaute erste deutsche
Stahlfördergerüst des Schachtes Barillon hatte zwei Hängebänke und
ruhte auf einem 5 Meter hohen Mauerfundament mit diesem es fest
verbunden war. Eine sehr ähnliche Bauart wurde nachfolgend (um
1875) auch für das Gerüst des Schachtes Osterfeld I (Oberhausen
III) gewählt. Aufgrund der auftretenden hohen Kräfte an den
fördermaschinenseitigen Eckstützen war es allerdings notwendig
diese besonders massiv auszuführen. Zusammen mit den aussteifenden
Riegeln und Diagonalstäben führte dies aber zu einem enorm hohen
Materialaufwand und die Bauform verlor kostenseitig recht schnell
an Bedeutung. Ein erneuter Brand der Tagesanlagen auf Barillon im
Jahr 1872 verdeutlichte aber die Überlegenheit der Stahlgerüste.
Bei diesem Brand wurden fast die kompletten hölzernen Tagesanlagen
stark in Mitleidenschaft gezogen, das Gerüst hatte zwar auch
gelitten, dieses blieb aber nach dem Ablöschen und dem Ersetzen
der durchgebrannten Aloeförderseile und einiger Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten weiterhin betriebsbereit.
Auf einem auf Shamrock I/II errichteten Gerüst gleicher Bauart
musste nachträglich aber noch ein Stützstrebenpaar installiert
werden, da das Gerüst den Zugkräften der Fördermaschine nicht
standhielt.
Heute kann wegen einer Brauchbarkeit dieser Gerüstform für den
Förderbetrieb leider nur noch gemutmaßt werden, aber anscheinend
konnte dieser erste Versuch nicht vollständig überzeugen. Diese
Gerüstform hatte mit so manchen Kinderkrankheiten des frühen
Stahlhochbaues zu kämpfen. Nachteilig wirkten sich sicherlich die
benötigte große Grundfläche, die notwendige Durchdringung der
Struktur auf den beiden Hängebänken (unter Wegfall der aussteifenden
Diagonalstäbe), die vielen genieteten Anschlüsse sowie die schon
angesprochene Instabilität bei nicht genügender Dimensionierung aus.
Auch hatte die notwendige Wahl der Seilscheibengröße einen Einfluss
auf den Standort über der Schachtscheibe. Das Gerüst konnte nicht
zentriert über dem Schacht gebaut werden, da sonst entweder die
komplette Konstruktion deutlich hätte vergrößert werden müssen, oder
aber die Seilscheibenbühne für den Durchgang der Seilscheiben hätte
geteilt werden müssen, was nur unter hohem konstruktiven Aufwand
möglich gewesen wäre.
Das Pyramidengerüst von Osterfeld I (Oberhausen III - 1944 durch
Bombenwurf zerstört) sowie das gut dreißig Jahre später gebaute
Bockgerüst von Rheinelbe III (1926 stillgelegt, nachfolgend von
Holland genutzt und vor 1966 abgerissen) haben aber über Jahrzehnte
klaglos funktioniert; diese allerdings nicht als Hauptförderung!

Abbildung 2: Das 1870 von der Essener
Maschinenfabrik "Union" auf der Zeche Graf Beust errichtete
Strebengerüst konnte schon damals als zukunftsweisend erachtet
werden. Allerdings wurden zu dieser Zeit noch drei aus Flacheisen
bestehende Zuganker (rot) benötigt um das Stahl sparende und somit
leichte Traggerüst; besonders aber die Streben dauerhaft zu
belasten und so ein Umstürzen bei evtl. Seilbrüchen zu verhindern.
Die beiden Streben sind hier bereits fischbauchförmig ausgeführt,
da schon damals eine möglichst hohe Knicksteifigkeit von Bauteilen
bei möglichst geringer Dimensionierung gefordert wurde.
Wenn auch die von Geisler entworfene 13,3 m hohe Stahlkonstruktion
nach heutigen Maßstäben deutliche Fehler aufweist und sich im
damaligen Förderbetrieb wohl nicht unbedingt bewährte,
so ist diese doch als Quantensprung der Schachtfördertechnik zu
sehen. Ausschlaggebend für die einmalige Ausführung (es wurde kein
zweites Gerüst dieser Bauart errichtet) scheinen die starken
Schwingungen und Querneigungen gewesen zu sein, welche sich beim
Förderbetrieb einstellten. Dies ist wohl auf die nicht ausgereifte
Konstruktion des Gerüstkopfes sowie der geringen Stützbreite der
Streben zurückzuführen und wurde sicherlich noch durch den damals
notwendigen Einsatz der Zugstangen verstärkt, welche den
Gerüstkopf nicht genügend stabilisieren konnten. Deutlich sichtbar
ist bei dieser Urform aber die enge Verwandtschaft mit den später
ausgeführten Bauformen.

Die Fachwerkbauweise, welche von 1870
bis etwa 1930 vorherrschte, wurde ab 1925 durch die Profilbauweise
(Vollwand) abgelöst. Diese wiederum wurde um 1960 von der
Kastenbauweise verdrängt.
Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Ausführungen werde ich hier
nur auf die gängigsten bzw. auf die für mich besonders interessanten
Fördergerüste eingehen. Ich versuche hiermit, eine kleine Übersicht
über die Entwicklung der Förderanlagen im Ruhrgebiet zu geben. Die
verschiedenen Arten der Schachthäuser und Malakofftürme werden hier
nur angeschnitten; das Augenmerk liegt auf den Fördergerüsten.
Eine vollständige Übersicht aller in Deutschland eingesetzten
Gerüsttypen wird es aber wegen der Vielzahl an Arten und Formen wohl
nie geben...
Übersicht der Gerüstarten:
| Haspel, Göpel, Wasserkehrräder, Treträder und Schachthäuser: | ||
|
Der Haspel ist die erste
und einfachste Art ein Fördergut zu Tage zu heben. Dieser
war zu den Anfängen ein Einrichtung, die von der
Brunnenförderung (Wasserziehbrunnen) übernommen wurde. |
||
 |
Der Handhaspel gilt als die erste mechanische Fördereinrichtung. Dieser konnte aber nur etwa 4 t/Schicht aus geringer Tiefe (-20 m) zutage heben. | |
 |
Der Pferdegöpel ist im eigentlichen Sinn noch kein Fördergerüst, aber der erste Schritt zu einer mechanischen Förderung. | |
|
|
||
| Malakofftürme: | ||
|
Der Malakoffturm gilt als Weiterentwicklung des
Schachthauses. Diese wurde notwenig, da in Folge der
Einführung der Dampfmaschine als Antriebsquelle die
übertägig aufgestellten Wasserhaltungsmaschinen sowie die
Fahrkünste oder Trommelfördermaschinen unmittelbar in
Schachtnähe montiert werden mussten. Auch mussten die
Förderkörbe nun Mehretagig ausgeführt werden, um eine
höhere Förderleistung pro Seilfahrt zu erbringen.
|
||
|
|
||
| Fachwerkbauweise: | ||
| Bockgerüste: Zwei- und dreibeiniges Bockgerüst |
||
|
Nach dem Land der größten damaligen
Verbreitung auch englischer Bock genannt. Geografisch
zuordnen lässt sich diese Gerüstart allerdings nicht
eindeutig, da diese Bauart in allen Bergbaugebieten
eingesetzt wurde. |
||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| einfaches Bockgerüst | Hibernia I | |
 |
 |
|
| Gneisenau II | ||
 |
 |
|
 |
 |
|
| Spurlattenführung | ||
 |
 |
|
| Seilführung | Bauart
Tomson Bock Robert Müser - Schacht Jacob |
|
| Zweigeschossig: | ||
 |
 |
|
| Neu-Iserlohn II
Übergangsform von 4- auf 2-beinig |
Roland II | |
|
|
||
| Pyramidengerüste: Vierbeiniges Bockgerüst |
||
|
Das Pyramidengerüst ist eine
eigenständige Entwicklung, da die vertikale Standsicherheit
bei den Bockgerüsten oft nicht ausreichend war. Hierbei
wurden die Stützen (bzw. Streben) weiter vom Schacht
entfernt um eine ausreichende Standfestigkeit zu erhalten.
In späterer Ausführung wurde es aber weitere Stützstreben
erweitert um die anfallende Knicklast der Stützen, welche
der Fördermaschinen zugewandt sind, zu verteilen. Teilweise
wurde dies auch unter dem kompletten Wegfall (bzw. der
Verlagerung) dieser erreicht. Diese Art von Gerüsten wurde
aber im Ruhrgebiet nur kurzzeitig ausgeführt (etwa bis
1890), da diese bezüglich des hohen Materialaufwands und der
Stabilität noch ungenügend waren. Spätere in Frankreich
erbaute Pyramiedengerüste genügten der Standfestigkeit,
dieser Umstand musste aber mittels eines enormen
konstruktiven Aufwandes und Materialeinsatz erkauft werden.
|
||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| Barillon (Julia) | ||
 |
 |
|
 |
 |
|
| Ver. Gideon - tonnlägiger Schacht | Hannibal I "eingerüsteter Malakoff" | |
 |
||
|
Rheinelbe III - Vierbeiniges Bockgerüst mit um 90° versetzter Notförderung |
||
|
|
||
| Strebengerüste: | ||
|
Das Strebengerüst ist wiederum eine
Weiterentwicklung des Pyramiden- sowie des Bockgerüstes und
vereinigt die Vorteile beider in sich. Ab 1874 wurde eine
Sonderbauform (Promnitz) dieser als deutsches Strebengerüst
bekannt. Es zeichnet sich durch eine schmale Stützenform
(bezogen auf den Schachtdurchmesser) und durch weit stehende
Streben aus. Da diese Gerüste zu Anfang vorwiegend für eine
Trommelförderung vorgesehen waren, war die Ausführung
besonders bei dem Betrieb vorteilhaft, da somit die
Stützlasten auf die Streben verteilt wurde und so die
wirkenden Kräfte (Kraftvektor zwischen Stütze und Seil)
bestmöglich aufgenommen und abgeleitet wurden. Weiterhin
konnte durch diese Anordnung der Bereich des Schachtes von
störenden Einbauten freigehalten werden, welches besonders
vorteilhaft für die notwendigen Zu- bzw.
Abführungseinrichtungen war und den Schachtbetrieb deutlich
vereinfachte.
Ab 1877 führte wiederum Promitz auch das zweigeschossige Strebengerüst ein, wobei er die Koepescheibe als Antriebsmedium nutzte. |
||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| abgespannte Stützen und Streben - Bauart Geisler | Bauart Promnitz 2 Carolinenglück III |
|
 |
 |
|
| Bauart Promnitz 1
Teutoburgia II |
Werne II | |
 |
 |
|
| Bauart Promnitz 3
Friedrich Thyssen VI |
Beeckerwerth II | |
 |
 |
|
| Beeckerwerth I | Bauart Zschetsche | |
 |
 |
|
| Bauart Saar | Bauart Klönne | |
 |
 |
|
| Möller II | Bauart Humboldt | |
 |
||
| Bauart Gehlen | ||
|
|
||
| Zweigeschossig: | ||
 |
 |
|
| Elisabethenglück | Herkules I | |
 |
 |
|
| Zollverein II | Amalie Schacht Barbara | |
 |
 |
|
| Dannenbaum I | Ewald IV | |
 |
 |
|
| Rosenblumendelle II | Sälzer-Amalie Schacht Marie | |
 |
||
| Rheinpreussen II | ||
| Doppelstrebengerüste: | ||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| Alma III | Deutscher Kaiser I | |
 |
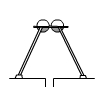 |
|
| Amalie 2 | Hugo 1 - II | |
| Zweigeschossig: | ||
 |
 |
|
| Consolidation VIII | Zollverein IV | |
 |
 |
|
| Hannover III (Dreibein) | Borth II | |
|
|
||
| Profilbauweise: | ||
| Vollwandgerüste: | ||
| Einstrebengerüste | ||
|
Das erste vollwandige deutsche Fördergerüst wurde 1925 über dem Schacht 1 (Baden) des Kalisalzbergwerks Buggingen in Baden errichtet. Diese Bauform ist deutlich einfacher ausgeführt, bietet jedoch dieselben Vorteile eines Fachwerkstrebengerüstes bei allerdings besserer Knicksteifigkeit und einem nur geringen (~5%) Materialmehraufwand. Die aufwendige Nietkonstruktion der Fachwerkbauweise und die damit einhergehenden Probleme der Steifigkeit und der Korrosionsanfälligkeit bei längeren Betriebszeiten entfielen hierbei. Weiterhin konnte durch den Einsatz von Vollwandprofilen die Erstellungszeit sowie die nachfolgende Wartung und Instandhaltung deutlich minimiert werden.
|
||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| Dörnen Robert Müser |
Dörnen 2 Zollverein I |
|
 |
 |
|
| Schwerin I mit geknickter Strebe auf Malakoffturm | Friedrich Thyssen II | |
|
|
||
| Zweigeschossig: | ||
 |
 |
|
| Dörnen 2 - Friedrich d.G. I | Bonifacius II | |
 |
||
| Friedrich-Heinrich III | ||
|
|
||
| Doppelstrebengerüste "ugs.: Doppelbock" | ||
|
Um einen Schacht optimal auszunutzen,
wurden zweiseitige Förderanlagen entwickelt, welche
unabhängig voneinander operieren können. Hierbei wurden die
Strebenpaare des Einstrebengerüstes dupliziert und als
Stützgerüst genutzt. Erste Versuche das Führungsgerüst als
zentrale dritte Stütze zu nutzen schlugen jedoch wegen der
zu großen Steifigkeit bei Bodensenkungen fehl. Wegen gerade
dieser besonderen Steifigkeit wurde aber das Führungsgerüst
nicht mehr als Stützkonstruktion benötigt und konnte daher
vom eigentlichen Fördergerüst statisch getrennt werden. Dies
Entkoppelung hatte besonders im Ruhrgebiet seine Vorteile,
da es dort oft infolge von schachtnahen Bergsenkungen zu
einer Schiefstellung der Fördereinrichtung kam.
|
||
 |
 |
|
| Zollverein XII | Centrum VII | |
 |
 |
|
| Gneisenau IV | Lohberg II | |
|
|
||
| Kastenprofile: | ||
| Einstrebenkastenprofil | ||
|
Die schwarz
dargestellten Profile sind als geschweißte Kastenprofile
(hohl) ausgeführt. Hierbei wurde der Materialaufwand
gegenüber dem Vollstrebengerüst bei gleicher oder meist
besserer Stabilität noch weiter reduziert. Auch sind hier
die zu erwartenden Korrosionsschädigungen durch den
konstruktiven Entfall von Nässestaupunkten an den
Stützenstößen oder Versteifungsblechen - wie sie vorher
bei den Vollwandgerüsten notwendig waren - auf ein
Mindestmaß reduziert worden.
|
||
| Eingeschossig: | ||
 |
 |
|
| Recklinghausen 2 - Schacht IV - Konrad Ende | Arenberg-Fortsetzung mit abgespannter Stütze (Dreibein) |
|
|
|
||
| Zweigeschossig: | ||
 |
 |
|
| Waltrop III | Niederberg IV | |
 |
 |
|
| Grimberg IV | Haus Aden VII - Schacht Romberg "Golfschläger" - ab 2002 ungesetzt nach BW Ost Schacht Lerche | |
 |
 |
|
| Ewald II | Kurl III | |
 |
 |
|
| Rossenray II | Osterfeld Nordschacht | |
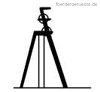 |
 |
|
| Hugo II mit abgespannter Stütze (Dreibein) | Wulfen II | |
|
|
||
| Viergeschossig: | ||
 |
||
| Grimberg II mit abgespannter Stütze | ||
| Doppelstrebenkastenprofil | ||
 |
||
| Auguste Victoria VIII | ||
| Betonbauweise: | ||||||||
|
Obwohl diese Bauweise preiswerter und
zudem deutlich wartungsärmer als die vergleichbarer
Stahlgerüste war, konnten sich Fördergerüste aus Beton
(Stahlbeton, Spannbeton) im Ruhrgebiet nicht durchsetzten.
Eine große Verbreitung fanden diese z.B. in Belgien,
Frankreich, Polen, Südafrika und Nordamerika. Dies hatte
wohl einerseits mit dem Stahlstandort Deutschland zu tun, da
es einfacher war Fördergerüste aus Stahl "von der Stange" zu
kaufen, andererseits war speziell im Ruhrgebiet die
Anfälligkeit auf Schiefstellung und die werkstoffbedingte
höhere Erstellungszeit (Bau + Aushärtung) von Nachteil.
Daher wurde bei der Betonbauweise für Förderanlagen später
eher zu den Turmförderanlagen tendiert, da diese bei
anhaltender Förderung und solider Gründung unmittelbar um
das alte Gerüst gebaut werden konnten. Ein Betongerüst in
leichter Strebenbauart (Dreipunktlagerung) wurde am
Niederrhein nur einmalig ausgeführt und nachfolgend wohl
aufgrund der hohen Gründungsproblematik oder aber der
fehlenden Erweiterbarkeit nicht mehr nachgeahmt!
|
||||||||
 |
 |
|||||||
| Consolidation IV | Polsum II - Wetterschacht | |||||||
| Turmgerüste / Turmförderanlagen: | ||||||||
|
Diese Sonderbauform ist unabhängig von
der Profilausformung. Die Stützenprofile sind aber zumeist
als Doppel T-Träger (H bzw. I-HD Breitflanschprofile) in
Rahmenbauweise (Fachwerke wurden wegen der hohen Kosten
zumeist vermieden) ausgeführt.
|
||||||||
| Turmgerüste | ||||||||
|
Bei Turmgerüsten steht die Fördermaschine
in unmittelbarer Nähe zum Schacht auf dem Niveau der
Hängebank. Diese Art ist als Fördergerüst
anzusehen. Das Stützgerüst ist aus Profilen in Fachwerk-
oder Rahmenbauweise erbaut. Die sonst notwendigen Streben
entfallen aber aufgrund der nahen Lage der Fördermaschine
zum Gerüst und der damit geringen Strebenlast (horizontale
Momente) hierbei komplett.
Zur Verdeutlichung sind die Seile sowie die Treibscheiben bei den folgenden Bildern dargestellt. |
||||||||
 |
 |
|||||||
| Minister Stein II | General Blumenthal VII | |||||||
 |
||||||||
| Wallsum I/II - Doppelförderung | ||||||||
|
|
||||||||
| Turmförderanlagen | ||||||||
|
Hierbei ist die Fördermaschine im oberen Kopfteil
installiert und diese wird umgangssprachlich Förderturm
genannt. Überwiegend wurden diese in streng kubischer
Bauform gehalten, wobei aber die sogenannten
Hammerkopftürme durch einen auskragenden Kopfteil eine
Ausnahme bildeten. Diese spezielle Bauform wurde aber ab
etwa 1930 wegen der stetig geringer werdenden
Dimensionierung der Turmfördermaschinen nicht mehr
ausgeführt. Vorteil bei allen Turmförderanlagen ist der
geringe Platzbedarf sowie der verhältnismäßig günstige
Baustoff. Nachteilig wirkten sich aber die erhöhten
Baukosten sowie die besondere Anfälligkeit auf
Schiefstellung aus, welche durch das hohe Eigengewicht
noch begünstigt wurde.
|
||||||||
 |
 |
|||||||
| Skelettbauweise: Hercules V |
Skelettbauweise: Katharina III - Ernst Tengelmann |
|||||||
 |
 |
|||||||
| Stahlbetonbauweise: Pörtingssiepen II |
Rahmenbauweise: Hammerkopfturm Minister Stein IV |
|||||||
|
Farbgebung der Schachtgerüste: Einen wohl eher untergeordneten Punkt der
Fördergerüstarten nimmt die Farbgebung der Förderanlagen
ein. Dennoch möchte ich recht oberflächlich auch auf diesen
kurz eingehen. Die lichtweißen Anstriche haben sich im Ruhrgebiet, im Gegensatz zum Saarland, nicht durchsetzten können. Besondere Ausnahmen im vorherrschenden
"Grün-beigen Allerlei": Die Oberfläche der Betonfördertürme wurden entweder natur belassen oder aber mit grün oder beige/weißen Trapetzblechen verkleidet. Stammbaum der Schachtfördereinrichtungen |
 |
| Kurzübersicht der Schachtförderarten |
|
Sicherlich können einige Besucher nichts mit den
Förderarten und den dazugehörenden Einrichtungen und
Machinen anfangen, daher eine sehr einfache Übersichtsgrafik
|


 Brockhauser Tiefb. |
Rheinpreussen | Fürst Hardenberg | Westhausen
Brockhauser Tiefb. |
Rheinpreussen | Fürst Hardenberg | Westhausen
 Die einzige erhaltene
Doppelanlage im Ruhrgebiet - Holland I/II nach/vor der
durchgeführten Sanierung. Erbaut wurde diese im Jahre
1860. Die ursprünglich eingezogenen Fördergerüste wurden
nach der Stilllegung entfernt.
Die einzige erhaltene
Doppelanlage im Ruhrgebiet - Holland I/II nach/vor der
durchgeführten Sanierung. Erbaut wurde diese im Jahre
1860. Die ursprünglich eingezogenen Fördergerüste wurden
nach der Stilllegung entfernt. 
 1. Koepeförderung - Treibscheibe
1. Koepeförderung - Treibscheibe